Hintergrund und Zielsetzung
Im Klinischen Risikomanagement wurden Informations- und Kommunikations-Defizite als eines der Top-Risiken in Krankenhäusern identifiziert. Insbesondere bei der Entlassung von Patient*innen kann es zu Versorgungsunterbrechungen kommen, wenn wichtige Informationen fehlen. Eine „sichere Entlassung“ benötigt daher jedenfalls ein umfassendes Entlassungsgespräch, rasch verfügbare ärztliche Entlassungsinformationen und gute Gesundheitsinformationen mit laienverständlichen Inhalten. Das Ziel dieses Projektes ist es, Best-Practice-Maßnahmen aus Vorprojekten sowie evidenzbasierte Maßnahmen zur Verbesserung der Gesprächsführung innerhalb und außerhalb der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m. b. H. (KAGes) auszurollen.
Methodik
- Es werden neue Gesundheitsinformationen nach definierten Qualitätskriterien für Patient*innen und deren Angehörige erstellt, welche durch Patient*innen getestet und dann KAGes-weit eingesetzt werden.
- Das E-Learning zum Thema „ärztlicher Entlassungsbrief“ wird von neu eintretenden Ärzten und Ärztinnen der KAGes und der BHB Graz absolviert.
- Das E-Learning wird auch in Kooperation mit ASQS für weitere Ärzte und Ärztinnen angeboten.
- Es werden Kommunikationstrainings nach dem ÖPGK-tEACH-Standard angeboten und von Mitarbeiter*innen der KAGes und der BHB Graz absolviert.
- Es werden Workshops für Ersteller*innen von guter Gesundheitsinformation angeboten und von Mitarbeiter*innen der KAGes und der BHB Graz absolviert.
- Teilnehmer*innen aus anderen Institutionen sind bei Vorhandensein von verfügbaren Plätzen bei den Workshops willkommen.
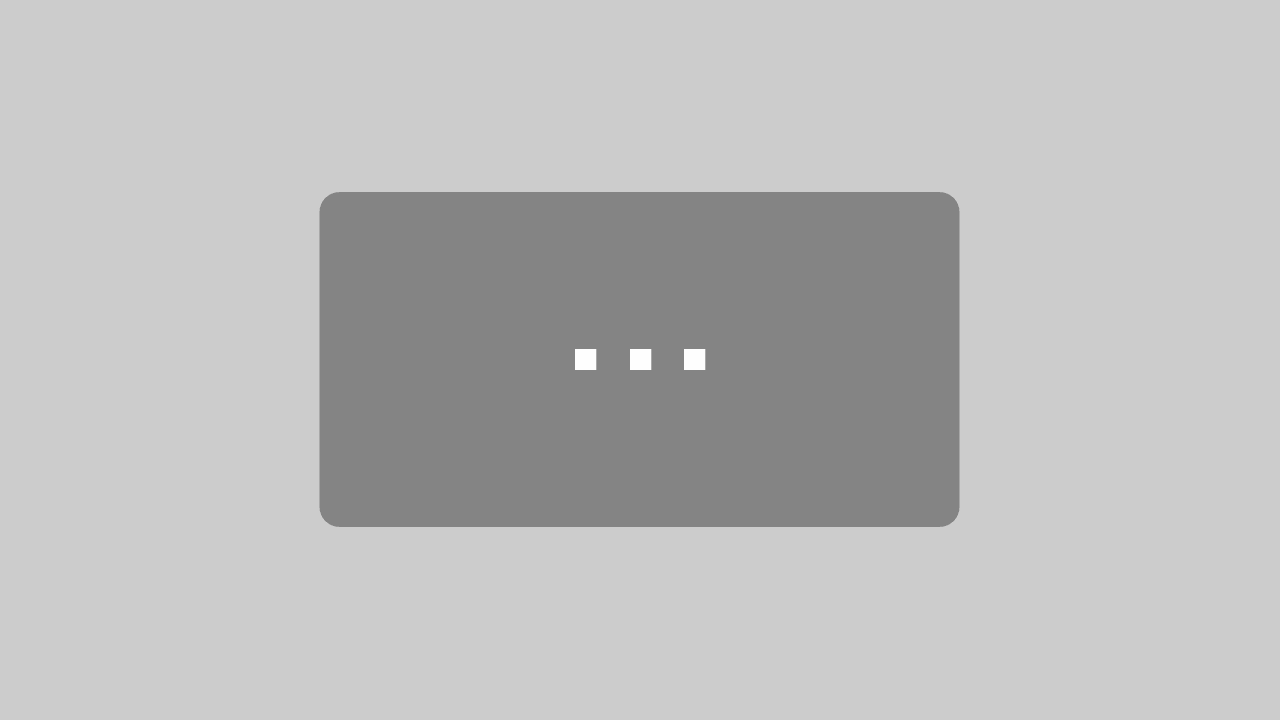
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
